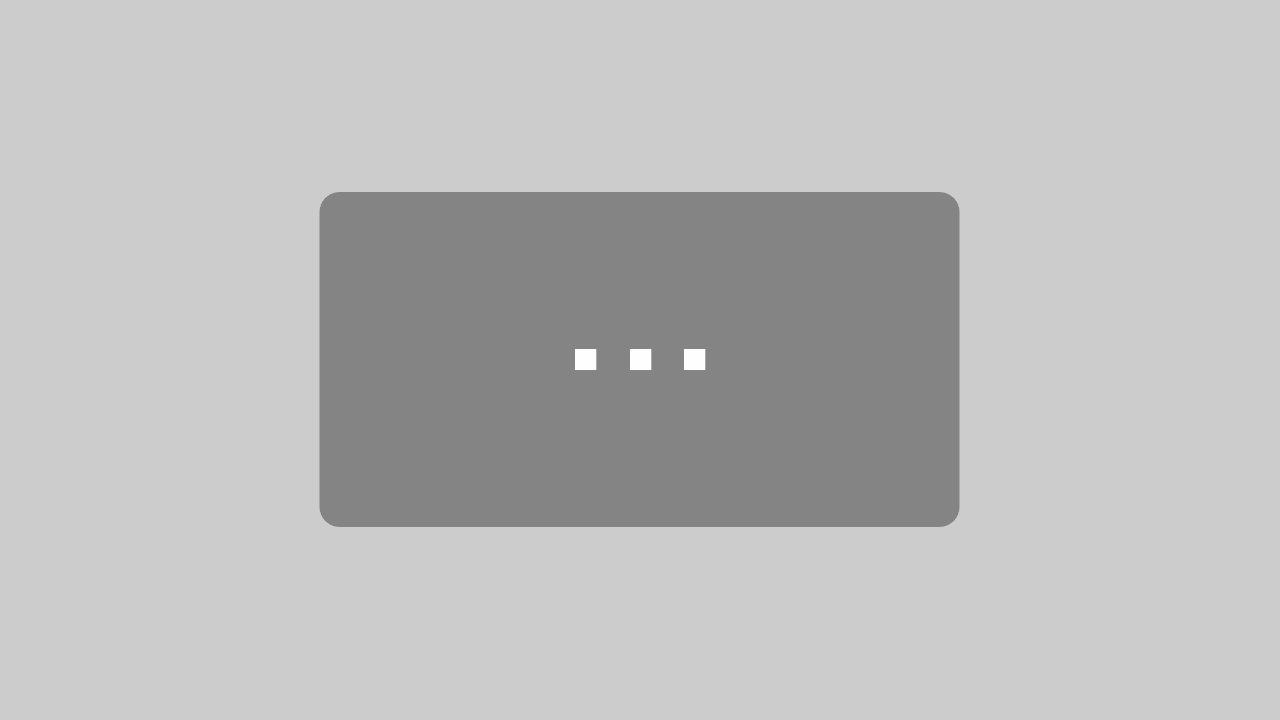Lepidoptera
Umfang, Digitalisierung
Die Schmetterlingssammlung der ZSM umfasst ca. 12 Millionen Exemplare in weit über 130.000 Arten. Diese sind in über 80.000 Kästen untergebracht. Mehrere Privatsammlungen wurden der ZSM bereits übereignet, befinden sich jedoch derzeit noch in Obhut und Pflege der jeweiligen Fachamateure. Über 4 Millionen Falter (Museum Thomas Witt) sind durch die Errichtung der gemeinnützigen Stiftung Thomas Witt sowie durch umfangreiche Schenkungen in den Jahren 2010 und 2011 den staatlichen Beständen der ZSM assoziiert bzw. in diese übergegangen. Damit ist die Münchner Sammlung mit Abstand die größte Schmetterlingssammlung in Deutschland, und auch international gehört sie zu den umfangreichsten und bedeutendsten. Moderne Unterbringung in großzügigen Räumlichkeiten, hoher Ordnungsgrad und leichte, benutzerfreundliche Zugänglichkeit des Materiales aufgrund der nahezu kompletten Art-Inventarisierung in Datenbanken sind weitere Markenzeichen der Münchener Schmetterlingssammlung. Für viele tausend Arten und Unterarten beherbergt die Sammlung die Originale, die sogenannten (namenstragenden) Typenexemplare. Eine genauere Zahl wird in absehbarer Zeit der Fortgang der EDV-Inventarisierung ergeben. Im Falle der über 3.300 Holotypen des Museums Witt (mit >87.000 Paratypen) ist Inventarisierung und Webpräsentation bereits abgeschlossen.
Schwerpunkte
Die Schwerpunkte der Sammlungsbestände liegen bei den Tagfaltern (Rhopalocera) und Spannern (Geometridae). Die spinnerartigen Nachtfalter bilden den Schwerpunkt des Museums Thomas Witt (siehe homepage des MWM). Durch die Übereignung der sechs bedeutenden Kleinschmetterlingssammlungen (Microlepidoptera) Klimesch, Eitschberger, Pröse, Deschka, Derra und Grünewald konnten in den letzten Jahren mit ca. 600.000 neuen Exemplaren auch hier die Bestände deutlich erweitert werden. Weitere bemerkenswerte Sammlungen sind die Sammlung Esper (aus den Jahren 1770 – 1805), Herbulot (mit den historischen Sammlungen Mabille, Rambur, Chrétien, D. Lucas), Daumiller, Bastelberger, Disqué, Dannehl, Alberti, Eisenberger, Gehlen, Hirmer, Hörhammer, Koehler, Lukasch, Osthelder, Vogl, Speckmeier, Beyerl, Wolfsberger, Kager, Hinterholzer, Politzar, Behounek, Hacker, Scheuringer, Wegner, Darge, Ochse, Vitale, Taschner, Oswald, Müller, Zahm, Conde de Saro, van Schayck, Brechlin, Beeke, Löbel, Stadie, Fiebig, May, Weigert. Neben einheimischem Material ist vor allem der Mittelmeerraum, Nepal (ca. 500.000 Falter aus den ZSM-Expeditionen, v. a. von Dr. W. Dierl), Sumatra (v.a. Material der Heterocera Sumatrana Society), Taiwan (eigene Aufsammlungen), Afrika (Tanzania: Ph. Darge; Südafrika: eigene Aufsammlungen; Äthiopien, Mali, Guinea, Kongo: G. Müller, R. Beck, B. Fruth u.a.) und Südamerika (historische Stücke gesammelt von I.K.H.Prinzessin Therese von Bayern, Material aus vielfachen Kooperationsprojekten, Aufsammlungen durch Dr. W. Forster und durch das Projekt Panguana der ZSM) durch besonders reichhaltiges Belegmaterial abgedeckt.
Forschung
Die Forschungsschwerpunkte liegen derzeit in der Taxonomie (inklusive molekulare Methoden, z.B. DNA Barcoding und molekulare Phylogenie) und Systematik der Familien Geometridae und Pyralidae, sind sammlungsbezogen und von mehreren bedeutenden Drittmittelprojekten (z.B. iBOL; BFB, Barcoding Fauna Bavarica; GBOL; EU-Horizon-BGE) unterstützt. In der internationalen, öffentlichen Datenbank für DNA-Sequenzdaten (BOLD, Canada) liegt die SNSB/ZSM im weltweiten Ranking an zweiter Stelle, wobei die Schmetterlinge mit über 120.000 sequenzierten Belegstücken aus der Sammlung den wichtigsten Anteil stellt. Auch dürfte ein aus dem Jahr 1788 stammender, erfolgreich sequenzierter Falter unserer Sammlung den Altersrekord für DNA-Sequenzdaten darstellen. In verschiedensten Kooperationsprojekten mit Partnern aus aller Welt werden diese Daten für biologische Forschung genutzt.
Wozu sammeln, warum so viele?
Nach Augustinus können wir nur das lieben und wertschätzen, was wir kennen. Deshalb ist die Kenntnis und die Erforschung unserer Natur essentiell für die Wertschätzung und für den Erhalt der Geschöpfe und Lebensräume auf unserem Planeten. Unsere Sammlungen dokumentieren in nachhaltiger und verlässlicher Weise die Biodiversität (Artenvielfalt) für deren wissenschaftliche Bearbeitung.
Schmetterlinge stellen eine sehr artenreiche Gruppe dar, bisher wurden weltweit knapp 200.000 Arten beschrieben und man schätzt die Gesamtartenzahl inklusive der noch unbeschriebenen Arten auf mindestens eine halbe Million. In Sammlungen werden Hunderte von Individuen pro Art benötigt, um sämtliche Aspekte rund um eine Art verlässlich und umfassend zu dokumentieren, wie z.B. Variationsbreite in Färbung und Struktur, Unterschiede zwischen den Geschlechtern, geografische Verbreitung, Höhenverbreitung, jahreszeitliche Aktivitätsmaxima, Hinweise auf besondere Lebensraumansprüche u.s.w. Dies bedeutet, dass eine „komplette“ Sammlung der Schmetterlinge unseres Planeten mindestens 200 x 500.000 = 100 Millionen Belegstücke umfassen müsste. Da Schmetterlinge in die verschiedensten Habitate eingenischt sind (Ozeane und Polkappen ausgenommen) und jede Art durch eine arttypische Lebensweise charakterisiert ist, stellen sie in der Wissenschaft eine herausragende Modellgruppe für Forschungsprojekte aller Art dar.
Schmetterlinge werden zudem in der Öffentlichkeit als Sympathieträger wahrgenommen und eignen sich daher in besonderer Weise für die Vermittlung von Inhalten und Erkenntnissen aus der Wissenschaft, z.B. Artensterben, Ökologie, Naturschutz, Evolution u.s.w.